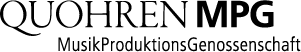19. November 2017

Tworna beim Creole Festival und ein Brief an Arne Birkenstock
Am 10.11. haben wir mit TWORNA in der alten Besetzung (also Katharina Johansson, Caterina Other und ich) beim Creole Weltmusik-Festival in Hannover zusammen mit den 14 Gewinnerbands der anderen Creole-Regionalausscheide gespielt. Wir wurden als eine von zwei Bands aus Mitteldeutschland (Sachsen, Sachsen Anhalt und Thüringen) nominiert. Im Vorfeld wurde uns gesagt, dass es viel Überzeugungskraft gekostet hat uns da unterzubringen, schliesslich singen wir auf deutsch und kommen aus Sachsen, was ja momentan nicht unbedingt positiv beleumunded ist. Und dummerweise stand auf dem Plakat der Creole, dass wir „Deutsche Volkslieder in neuem Gewand“ interpretieren und aus Dresden kommen (Deutsch, Volk, Dresden, oh je!). Unser Slogan „Weltmusik aus der Heimat“, der gut trifft, was wir machen, ist leider irgendwie untergegangen.
Das Festival war super organisiert (ein ganz grosses Kompliment an die Veranstalter!): sehr freundliche Mitarbeiter, super Tontechniker, eine sehr gute Bühne, tolle PA, Hotel 5min entfernt. Das allerbeste jedoch waren die anderen Bands. Wir haben wunderbare Musiker kennenlernen dürfen und tolle Konzerte gehört und gesehen. Da das ganze als Wettbewerb angelegt war (14 Gewinner der regionalen Creole Ausscheide spielen um 5 Preise) waren wir zwar irgendwie Konkurrenten und meiner Meinung nach entspricht das nicht unbedingt dem verbindenen Charakter der Musik, jedoch hat das unser herzliches kollegiales Verhältnis in keinster Weise geschmälert. Ich fand auch sehr bemerkenswert, wie breit das Spektrum der Musiken war, die die einzelnen Bands mitbrachten. Auf der Creole Seite bekommt man einen ganz guten Überblick über die vielen originellen Stile. Meine persönlichen Favoriten waren La Marche aus Frankfurt an der Oder, das Armaos Rastani Duo und The Sephardics aus NRW, wobei ich bei letzteren drei Lieder gebraucht hab, ehe die mich hatten. Die Konzerte durften nicht länger als 40min dauern und es wurde alternierend in zwei Sälen gespielt. Das hatte den Effekt, dass ein Teil des Publikums erst nach 10min kam und dann 10min eher ging.
Wir waren die zweite Band am Freitag abend, der Soundcheck lief gut und wir konnten im Backstage auch noch ein bisschen proben. Katharina war früh um 4Uhr in Schweden am Polarkreis gestartet und pünktlich zum Soundcheck da. Am nächsten Nachmittag war sie auch schon wieder bei ihren Kindern am Polarkreis, was für ein Ritt! Respekt!
Ich denke, dass wir unser bisher bestes Konzert gespielt haben. Wir hatten eine Hammer Sound und für mich war es eine tolle Entlastung, mal nur die Instrumente zu spielen und nicht gleichzeitig noch die PA im Blick zu haben. Nach drei Liedern war das Publikum herrlich euphorisiert, es wurde gejubelt und getrampelt und netterweise blieben die Menschen auch bis zum Ende unserer 40 Minuten. Und natürlich hat sich das auch auf unser Spiel ausgewirkt. Ich halte mich mit Selbstbeweihräucherung gerne zurück, aber diesmal haben wir wirklich gerockt. Durch die Limitierung auf 40 min haben wir relativ wenig Ansagen gemacht, um die Zeit mit unserer Musik zu füllen, und es waren am Ende dann auch 39:50 oder so. Nachdem wir fertig waren, haben wir in strahlende Gesichter geblickt und ein tolles Feedback bekommen. Gerade auch von den anderen Musikern, die uns mit sehr netten Worten bedachten. Eine ältere Frau hat mir gesagt, dass sie unser Konzert als eine tiefe Befreiung empfunden hat.
Aus Guitar Craft kenne ich den Aphorismus: „Expectation is a prison“. Ich habe gelernt, mit wenig Erwartungen in eine Sache zu gehen und so war ich nicht verwundert, als eine Stunde später die Retourkutsche vorbeifuhr und hielt. Wir hörten, dass ein Jurymitglied unser Konzert unter Protest verlassen hat, und zwar nach unserer Interpretation des „Heiderösleins“. Wir hätten eine Hymne auf eine Vergewaltigung gesungen. Und es fiel wohl auch das schlimme Wort: deutschtümelnd. Ganz schön starker Tobak auf einem Weltmusikfestival! Katharina hatte in einer Ansage gesagt, das Deutschland ja auch zur Welt gehört. Ja, das finde ich auch. Und ich fand es einzig schade, dass eben jener Mensch aus der Jury unser Konzert nicht bis zum Ende erlebt hat. Hätten wir uns halt erstmal vom Inhalt distanziert, dann hätte es vielleicht geklappt.
Wie auch immer. Eine herzliche Gratulation an alle Preisträger! Ihr habt es mehr als verdient! Und für uns war es auch toll, es gab eine Menge Gesprächsstoff, es wurde viel diskutiert und genau das möchte ich ja auch; dass eine Debatte angestossen wird. Nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich dann endlich mal Arne Birkenstock, dem Regisseur des wunderbaren Films „Sound of Heimat“ geschrieben. Der Film ist mein eigentlicher Grund, warum ich bei TWORNA bin, und das erzähle ich auch auf jedem Konzert (ausser in Hannover, 40min, wie gesagt). Und von ihm kam ein herrlicher Artikel, den ich hier im Anschluss poste. Lesen bildet:

Arne Birkenstock
Vom schwierigen Umgang mit dem SOUND OF HEIMAT
„Ein Kinofilm über deutsche Volksmusik?“ – Ich saß mit einem befreundeten Produzenten zusammen und erntete entgeisterte Blicke: „Das will doch keiner sehen“, meinte er und ich sah vor meinem geistigen Auge, was vor seinem geistigen Auge gerade ablief: Musikantenstadl, Volkstümelei, singende Spießer, wandernde Bundespräsidenten, Karnevalsschlager, womöglich auch noch braune Gesellen. Im Freundeskreis waren die Reaktionen ähnlich. Der kritische Deutsche wittert allzu oft unkritische Heimattümelei, wenn es um Volksmusik geht, denkt bestenfalls an die volkstümlichen Schlager, die das Fernsehen regelmäßig in die Altenheime dieser Republik überträgt.
All das bestärkte mich darin, meinen nächsten Film den Deutschen und ihrer ambivalenten Beziehung zu ihrer Volksmusik zu widmen. Warum lieben wir irische Kneipengesänge, argentinische Tangos und französische Musette-Walzer, zucken aber zusammen, wenn es um die Musik unserer Heimat geht? Oder, wie der Protagonist unseres Filmes, der neuseeländische Jazzmusiker Hayden Chisholm, während der Dreharbeiten verwundert feststellte: „Dieselben Menschen [in Deutschland], die feuchte Augen bekommen, wenn ein alter Indio in den Anden zum tausendsten Male „El Cóndor Pasa“ in seine Panflöte bläst, kriegen Pickel, wenn man sie auf die Melodien ihrer Heimat anspricht.“
Musik ist ein Emotionsspeicher. Oft sind es Lieder und Melodien, Rhythmen und Klänge, die es uns ermöglichen, wichtige Momente, berührende Begebenheiten, folgenreiche Begegnungen nicht nur zu erinnern, sondern auch emotional noch einmal zu durchleben. Das gilt auch und ganz besonders für die Orte, die uns etwas bedeuten. Ist eine Musik mit unserer Erinnerung an diese Orte verbunden, so können wir mit den Klängen dieser Musik weit mehr als die fotografische Erinnerung an einen Ort, sondern auch den Geruch, die Stimmung und unser Gefühl an diesem Ort wieder wachrufen.
Vermutlich gibt es auch deshalb auf der ganzen Welt Volksmusik. Vermutlich wird diese Volksmusik auch deshalb von Menschen, die fernab ihrer Heimat leben, häufig besonders intensiv gepflegt. Überall gibt es Tänze, Lieder und Rhythmen, die in einer bestimmten Region, einer bestimmten Tradition und Kultur, in einer Heimat verwurzelt sind. Heimat und Heimatmusik beeinflussen sich gegenseitig: Während der Jodler aus der Notwendigkeit heraus entstanden ist, in einer weitläufigen Berglandschaft über große Entfernungen miteinander zu kommunizieren, hat man in Río de Janeiro die Bossa Nova auch deshalb als sehr viel leisere Weiterentwicklung der Samba erfunden, weil die Enge der Großstadt und die Hellhörigkeit der Mietswohnungen dies schlicht notwendig machte. Viele dieser Volksmusiken haben ihre Heimat längst verlassen und als „Weltmusik“ Karriere gemacht, ohne ihre jeweiligen Wurzeln zu verlieren oder zu vergessen.
Nun muss es selbstverständlich überhaupt keine Volksmusik sein, mit der sich unser Emotionsspeicher füllt. Ein fremdes Lied, ein Streichquartett, ein exotischer Tanz – jede Art von Musik, die wir mit einem bewegenden Erlebnis oder einem besonderen Ort in
Verbindung bringen, geht in diesen Emotionsspeicher ein. Wir Deutschen lieben und rezipieren Weltmusik aus aller Herren Länder, die an ihrem Ursprungsort Volksmusik ist. Wir tanzen Tango, schlagen die Batucada-Trommeln in der örtlichen Sambagruppe, singen inbrünstig irische Gassenhauer oder üben uns in den Choreografien afrikanischer Tänze. Doch mit der eigenen Volksmusik scheinen wir ein Problem zu haben. Da ist zum einen der Plastikvorhang aus Musikantenstadl und volkstümlichen Schlager, der uns die Sicht auf schöne, ursprüngliche oder moderne Volksmusik verstellt. Doch kommerzielles Fernsehen und Schlager-Unkultur gibt es auch anderswo. Von der Stange gefertigte Schnulzen kleistern auch in Lateinamerika die Ohren der meisten Radiohörer zu.
Das Problem liegt hierzulande tiefer. Eine, aber nicht die einzige Erklärung ist der Nationalsozialismus. Ein ehemaliger Häftling aus dem Konzentrationslager Buchenwald erzählt in unserem Film die Geschichte vom „Frühlingslied“. Ein unschuldiges Kinderlied, fast jeder kennt es: „Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle“, heißt es in der ersten Zeile. In den Konzentrationslagern mussten die Häftlinge dieses Lied singen und zwar immer dann, wenn die NS-Schergen einen entlaufenen Häftling wieder eingefangen hatten und zum Schafott führten. Wer diese Situation durchlitten hat, für den hat dieses Lied seine Unschuld verloren. Und schon wer wie ich nur von dieser Geschichte gehört hat, der wird sich immer daran erinnern, wenn er dieses Lied hört und wird es – auch wenn er weiß, dass das Lied selbst ja nun für diesen zynischen Missbrauch gar nichts kann – vielleicht auch nicht mehr voller Inbrunst singen können.
Diese Geschichte erklärt für mich besser als jede musik- oder kulturtheoretische Abhandlung, warum das Mißtrauen gegenüber Volksmusik, gegen Begriffe wie Heimat und „Volksirgendetwas“ ganz allgemein, nach dem Krieg recht ausgeprägt war, übrigens auch bei Musikpädagogen. Dazu kommt, dass die Nazis zahllose Protagonisten anspruchsvoller und zugleich unterhaltsamer deutschsprachiger Musik ermordet und ins Exil getrieben haben. Was gab es in der Weimarer Republik für wunderbare deutsche Chansons! Komponisten und Textdichter wie Friedrich Holländer verbanden eingängige Melodien mit schmissigen Rhythmen und intelligentem Witz in den Texten. Nach dem Krieg kam der Schlager und die rigide Aufteilung von Musik in E wie „ernst“ und U wie „unterhaltend“. So wurde eine ganze lange Zeit weniger gesungen in unserem Land. Und ist diese Tradition einmal unterbrochen, so ist es langwierig und mühsam, sie wieder aufleben zu lassen. Wurde mit den Vätern als Kindern nicht gesungen, werden diese sich auch mit ihren eigenen Kindern dabei schwertun.
Und doch rührt sich das zarte Pflänzchen Volksmusik wieder. Denn das Bedürfnis nach Liedern und Tänzen ist da, darin unterscheiden sich die Deutschen nicht von anderen Völkern. Davon kann die riesige Chormusikszene hierzulande mehr als ein Lied singen und auch die zahlreiche Mitsingveranstaltungen, die überall in der Republik Hundertschaften zum gemeinsamen Singen in Kneipen und Kulturzentren locken, zeugen davon. Unser Film tat insofern auch das Gegenteil von dem, was seine Herstellung motivierte: Hayden Chisholms Reise wurde keine Reise in ein an Volksmusik armes Land. Unsere Reise führte uns ganz im Gegenteil großen Reichtum vor Augen: Wir bereisten wunderschöne, uns bis dahin unbekannte Landschaften,
labten uns an regionalen Köstlichkeiten mit und ohne Alkohol und lernten Volksmusiker kennen, die alles andere als hinterwäldlerisch sind, sondern die ihre regionale Musikkultur anreichern und weiter entwickeln. Sie öffneten uns die Tür in exotische, spannende und sehr berührende musikalische Welten. Dabei half, dass wir selbst Musiker sind und abends häufig mit unseren Protagonisten gemeinsam musizierten. Ihre Begeisterung steckte uns an, und offenbar konnten wir auch unser Publikum damit infizieren.
Noch nie hatte ich auf einen Film so berührte Rückmeldungen wie auf „SOUND OF HEIMAT“. In den Kinos wurde gelacht, gesungen und geweint. Eine Bonner Kinobetreiberin wählte unseren Film in einer Umfrage des Branchenmagazins Blickpunkt Film sogar zum Film des Jahres 2012 und schrieb: „Selten wurde 2012 im Kino so lautstark gelacht wie bei SOUND OF HEIMAT. Selbst das Publikumsgespräch endete mit einer Gesangseinlage: Guten Abend, gute Nacht … – das kann man beim besten Willen nicht zu Hause vor dem Apple-TV erleben. Das Kino als Verortung von Heimat at its best.“
Das Bedürfnis also ist da. Was vielen fehlt, ist das Repertoire. Wer kann schon ein ganzes deutsches Volkslied mit Refrain und Strophen auswendig vortragen? Als Student war ich in Argentinien, schleppte mein Akkordeonköfferchen zu den Peñas in kleine weinselige Studentenkneipen. Dort wurde die Gitarre herumgereicht. Ich hörte nordargentinische Tänze und Lieder. Alle Anwesenden sangen mit. Alle kannten die traditionellen Tanzschritte, die Rhythmen und meist auch die drei notwendigen Gitarrenakkorde zur Begleitung der Gesänge. Beeindruckend und schön. Auch hier irgendwann die Frage nach einer „canción alemana“. Schweigen bei den meisten der angesprochenen Landsleute.
Als Kölner hat man es da leichter. Der Karneval hat als Transmissionsriemen alle möglichen Mundartlieder hervorgebracht, nicht nur die aus der Fernsehsitzung bekannten Schlager- und Après-Ski-Dämlichkeiten, sondern eben auch wunderschöne Chansons über das Leben in der Großstadt. Und als Franke, Allgäuer oder Oberbayer hat man es vermutlich auch leichter. Wie in Köln so sprießen auch im Süden der Republik die Mundartbands wie die Pilze aus dem Boden. Volksmusiker im besten Sinne, die sich bei den Musikstilen dieser Welt bedienen, so wie es Volksmusiker schon immer getan haben – schließlich waren auch Polka und Rheinländer im Ursprung keine alpenländischen Tänze.
Und fängt man erst einmal an, richtig hinzuhören, dann wird man auch in Friesland und in Dithmarschen, in Wittenberg und im Erzgebirge fündig. Es gilt einen Schatz zu heben: traurige Lieder, deftige Lieder, kluge Lieder, innige Tänze, Fusionen aus alpenländischer Blasmusik und serbischem Tuba-Groove.
Und es gilt, unseren Emotionsspeicher aufzufüllen: Mit Melodien, Liedern und Tänzen aus unserer Heimat, wie immer wir diese jeweils definieren. Warum? Weil es schön ist und weil es uns ermöglicht, nicht nur zu erinnern, wie unsere Heimat aussieht, sondern auch, wie sie sich anhört.